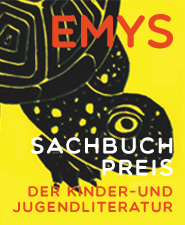- en
- de
Täuschende Zähne
13. September 2017
Manche Tiere ernähren sich anders, als es die Form ihrer Zähne vermuten lässt. Das zeigen aktuelle Untersuchungen an Kiefern des Geigenrochens, die ein Team um Mason Dean, Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm vorgenommen hat: Obwohl diese Rochen breite Zähne haben und normalerweise eher Muscheln und Garnelen fressen, machen sie offenbar auch Jagd auf Stachelrochen . Das verraten im Kiefer verborgene Bruchstücke von Stacheln. Für Zoologen und Paläontologen ist das ein Beleg dafür, dass man bei der Erforschung von Tieren künftig stärker nach Hinweisen auf Ernährungs- und Lebensgewohnheiten suchen sollte, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind.

Der Rochenjäger im Muschelfresser: Geigenrochen fressen auch Stachelrochen – auch wenn ihre runden Zähne das nicht vermuten lassen.
© Brian Gratwicke / Wikipedia / CC BY 2.0
Dass Tiere unterschiedliche Gebisse haben, lernen Kinder schon in der Schule. Hunde haben spitze Eckzähne, um Brocken aus ihrer Beute zu reißen. Kühe zermahlen mit ihren breiten Backenzähnen schwerverdauliche Grashalme. Ganz offensichtlich verraten Zähne und Kauapparate viel darüber, wovon sich ein Tier ernährt. Vor allem Paläontologen, die das Verhalten und die Evolution ausgestorbener Lebewesen nachvollziehen wollen, gibt die Gestalt von Zähnen wichtige Hinweise darauf, wie diese Tiere gelebt haben und mit ihrer Umwelt in Beziehung standen.
Mason Dean, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, hat zusammen mit Forscherkollegen aus England und den USA anhand des Kiefers eines Rochens jetzt nachgewiesen, dass die einfache Gleichung „Zeige mir deine Zähne, und ich sage dir, was du frisst“ nicht immer aufgeht – und dass man nur bedingt Rückschlüsse über die Lebensgewohnheiten eines Tieres ziehen kann, wenn man allein die Form der Zähne betrachtet. Dean ist Zoologe am Max-Planck-Institut Potsdam-Golm und arbeitet an der Schnittstelle zwischen Biologie und Materialforschung. Ihn interessiert insbesondere, wie Lebewesen bestimmte Gewebe wie Knorpel oder Knochen aufbauen und bei Verletzungen reparieren.
Schwanzstacheln im Kiefer
Um die Bildung von Knochen- und Knorpelstrukturen zu untersuchen, durchleuchtete er deshalb vor einiger Zeit den Kiefer eines Rochens der Gattung Rhynchobatus im Computertomographen (CT). Diese Rochen, die wegen ihrer Gestalt auch als Geigenrochen bezeichnet werden, leben unter anderem in den Gewässern um die Philippinen. Bisher nahm man an, dass sich Rhynchobatus von hartschaliger Nahrung wie Muscheln oder Krebsen ernährt. Seine Zähne sind rund wie Kieselsteine und offenbar gut geeignet, um zum Beispiel relativ glatte aber harte Muschelschalen zu knacken.
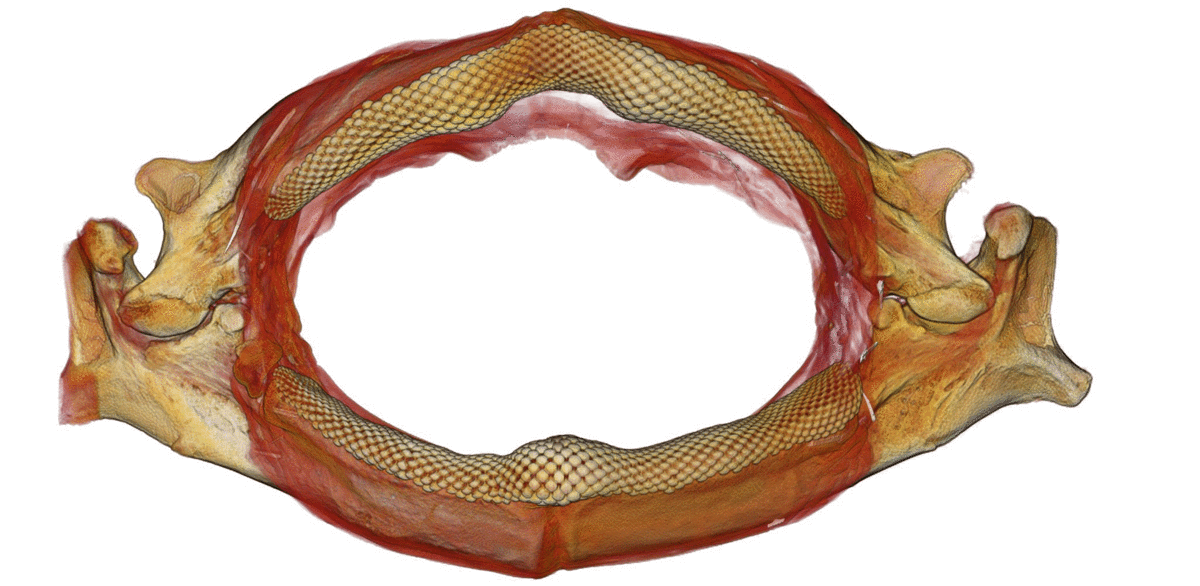
Pikanter Beigeschmack: Den untrüglichen Hinweis auf das bislang unbekannte Ernährungsverhalten von Geigenrochen lieferte eine Computertomografie des Gebisses eines Exemplars: Auf ihr waren eindeutig die Stacheln eines Stachelrochens im Kiefer des Knorpelfischs zu erkennen.
© Mason Dean/MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung
„Als wir die CT-Aufnahmen analysierten, waren wir total verblüfft“, sagt Mason Dean. „Der Rhynchobatus-Kiefer war mit vielen abgebrochenen Stacheln von Stachelrochen gespickt, die man von außen kaum erkennen konnte.“ Das bedeutete, dass das Rhynchobatus-Exemplar zahllose Stachelrochen verspeist hatte, die ihm beim Herunterschlucken ihre Schwanzstacheln in den Kiefer gejagt hatten.
Ein anderes Jagdverhalten als bislang gedacht
Diese wohl schmerzhafte Erfahrung hielt Rhynchobatus jedoch offensichtlich nicht von der Jagd auf weitere Stachelrochen ab. Die Ergebnisse der CT-Untersuchung werfen ein völlig neues Licht auf die Lebensweise von Rhynchobatus. Bisher dachte man, dass ausschließlich größere Haie mit ihren spitzen Zähnen Stachelrochen erbeuten. Für Dean und seine Kollegen ist das eine wichtige Erkenntnis zur Lebensweise dieser Art: „Allein anhand der Form der Zähne hätten wir nie darauf geschlossen, dass Rhynchobatus auch Stachelrochen jagt.“
Diese Daten zeigen, dass Rhynchobatus ein ganz anderes Jagverhalten beziehungsweise eine ganz andere Lebensweise an den Tag legen kann, als bisher gedacht. Obwohl es heute noch relativ viele dieser Rochen gibt, hatte offenbar kein Taucher dieses Fressverhalten je dokumentiert. Dean meint: „Diese Ergebnisse sind vor allem auch für Paläontologen interessant, zeigen sie doch, dass man aus der Analyse von Kiefern, Zähnen und Kauapparaten schnell falsche Schlüsse ziehen kann. Wir empfehlen daher, bei der Analyse von Fossilien künftig nach alternativen Indizien für bestimmte Fress- oder Lebensgewohnheiten zu suchen“. Das könnten neben deutlich sichtbaren Spuren der Abnutzung, auch mikroskopisch kleine Spuren und Kratzer sein, die einen Hinweis auf andere Nahrung geben. Interessant sei es auch, Fossilien oder Präparate von Tieren in Museen genauer zu untersuchen: „Wer weiß, welche Überraschungen die noch für uns bereit halten.“
Knochenähnliches Gewebe im Knorpelfisch
Für Mason Dean sind die Ergebnisse aber nicht nur in zoologischer und paläontologischer, sondern auch materialwissenschaftlicher Hinsicht interessant. Knorpel ist ein Gewebe, das kaum oder nur sehr schlecht verheilt. Das Skelett von Rhynchobatus aber besteht wie bei allen Hai- und Rochenarten zu einem großen Teil aus Knorpel und wird nur oberflächlich durch eine bestimmte Art von Knochenplatten stabilisiert. Anatomisch und auch evolutionär betrachtet, stellt dies eine Besonderheit der Knorpelfische gegenüber den Knochenskeletten der restlichen Wirbeltiere dar.
Eigentlich ist Knochen von Vorteil, weil er im Gegensatz zu Knorpel vollständig verheilen kann. Dennoch kommen Haie und Rochen seit Millionen von Jahren gut mit ihrem Knorpelskelett zurecht. In den CT-Aufnahmen konnten Dean und seine Kollegen nun sehr gut erkennen, dass die abgebrochenen Stachelspitzen offenbar von einer festen, knochenartigen Hülle, dem Callus, umwachsen worden sind. „Es muss also im Knorpelskelett dieser Fische einen Stoffwechselprozess geben, mit dem die Tiere knochenähnliche, mineralische Gewebe neu bilden können“, sagt Mason Dean. „Welche Prozesse das sind und inwieweit sie der Knochenheilung ähneln, wollen wir jetzt weiter erforschen.“
TS